Monster-Krieg: Mit Humor gegen die CCTV-Propaganda

Vergangenen Montag, dem letzten Tag der chinesischen Neujahrsferien, bot sich ein schauriges Spektakel in der Pekinger Innenstadt. Ein Teil der brandneuen Firmenzentrale des chinesischen Staatsfernsehens, zentral im architektonischen Vorzeigeviertel Pekings gelegen, ging in Flammen auf. Das Flammeninferno, dem ein Feuerwehrmann zum Opfer fiel, hatten Mitarbeiter von CCTV selbst verursacht. Das Management von CCTV ließ nahe des noch unfertigen Gebäudekomplexes ein professionelles Feuerwerk entzünden, um spektakuläres Filmmaterial, das jedoch weitaus spektakulärer ausfiel als ursprünglich gedacht, zu produzieren. CCTV entschuldigte sich kurze Zeit später in einem ungewöhnlichem Schritt öffentlich für die Vernichtung von Steuergeldern in Millionenhöhe.
Obwohl die Nachrichtenagentur Xinhua seine LeserInnen über den Vorfall informierte, bemühten sich offenbar die Zensurbehörden, die Verbreitung von allem Bildmaterial zu unterbinden. Jedoch vergeblich, denn noch bevor Xinhua den Brand meldete, kursierten dutzende private Videoaufnahmen, Handybilder etc. in Internetforen und Twitternetzwerken. Daher erschien es vielen als absurd, dass CCTV in den Abendnachrichten nicht über den Großbrand berichtete und auch ansonsten kein Bildmaterial im offiziellen Internet und Fernsehen zu finden war.

Der Ärger über CCTV schlägt inzwischen hohe Wellen. Chinesische Internetbürger (Netizens) begrüßen die Feuersbrunst mitunter als langersehntes "Gottesurteil" . Sie begannen eine regelrechte Schlacht gegen die Senderfamilie zu führen. In Karrikaturen zerstören Monster, Drachen und Alliens das CCTV-Hochaus. Die Hauptursache für den Unmut ist die Propaganda, die im staatlichen Fernsehen als ausgewogene Nachrichtenberichterstattung ausgegeben wird (siehe hier, hier und hier). Viele Medienkonsumenten scheinen entgültig genug zu haben von der zensierten Dauerbeschallung. Mitte Januar 2009 riefen Intellektuelle zu einem Boykott der Sendergruppe auf wegen ihrer unaufhörlichen parteilichen Berichterstattung, die Zuhörer und Zuseher einer regelrechten "Gehirnwäsche" unterziehe.
CCTV steckt in einer totalen Glauwürdigkeitskrise. Das Medienkonglomerat gerät zudem für seine Haltung, die ohne jegliche Selbstreflexion und Eigenkritik auskommt und von maßloser Arroganz geprägt ist, in heftige Kritik. So versäumte es CCTV, dessen übermächtige Informationsverbreitung vor allem dazu dient, einen harmonischen Eindruck zu erzeugen, den Milchpulverskandal (früher) bekannt zu machen. Damit missachtete das staatliche Fernsehen nicht nur seine Aufgabe, die Allgemeinheit über Gefahren aufzuklären, sondern hat vermutlich die Opfer des Skandals mitverschuldet. Ganz gleich ob "gute" oder "schlechte" Nachrichten, was und wie CCTV berichtet, nimmt kaum mehr jemand ernst (vgl. z.B. den Kommentar von Blogger Han Han). Von diesem Misstrauen zeugt auch die Anti-CCTV Website, die in Analogie zur Anti-CNN, falsche, unvollständige und verzerrte Meldungen aufdeckt.
Die Wut gegen CCTV ist aber auch Ausdruck einer äußerst volatilen Situation im ganzen Land. Die kreative Bilderschlacht mit Online-Monsters steht nicht nur in bester Tradition des chinesischen Humors, ohnehin die schärfste und alltäglichste Waffe gegen die mediale Gehirnwäsche der KPCh. Sie zeigt, wie Chinas BürgerInnen in der momentanen Stimmungslage Zufallsereignisse blitzschnell nutzen, um (sinnbildlich) die Waffen gegen die Regierungspropaganda und ihre Instrumente zu erheben. Zwar ist CCTV der unmittelbare Empfänger von Spott und Schadenfreude, doch richtet sich der angestaute Ärger letztlich gegen die KPCh selbst, nach dem Motto "die Akazie schelten, dabei aber auf den Maulbeerbaum zeigen" (zhi sang ma huai). Die Schriftzeichen 草泥马 über dem CCTV-Hochhaus im oberen Bild verweisen auf einen im Internet berühmt gewordenen Kindersong (cao ni ma), der mit sarkastischen Textveränderterungen die Bemühungen der KPCh, eine "harmonische Gesellschaft" zu schaffen, durch den Kakao zieht (Dank an Kankan für den Hinweis, weitere Analysen hier).
Über die Bedeutung der zahlreichen "schlechten Omen" für das Jahr 2009 lässt sich streiten, dass die chinesische Regierung nicht falsch liegt, wenn sie mit einer unruhigen Zeit rechnet, scheint indes unstrittig. Ich würde sogar noch weiter gehen und die These wagen, dass seit 1989 die Möglichkeit grundstürzender Umwälzungen niemals größer war. Drei Faktorenbündel sind hierfür ausschlaggebend: sich rasch ausweitende Unruhen und Kriminalität auf den Land und in den kleineren Städten, die mit der Massenarbeitslosigkeit unter den WanderarbeiterInnen zusammenhängt, organisierte Protestaktionen der Arbeiterschichten in den Städten (Wanderarbeiter eingeschlossen, siehe das Fallbeispiel Xinji) und die erneute Bereitschaft vieler Intellektueller/Wissenschaftler und Rechtanwälte sich zu organisieren und ohne Rücksicht auf Verluste gegen das Regime einzutreten (zuletzt im Rahmen der Charta 08) sowie die diffuse Unzufriedenheit innerhalb der jungen Generation der städtischen Bevölkerung. Jedes dieser drei Phänomene wird von der weltweiten Wirtschaftskrise, von der Exportweltmeister China unter den asiatischen Ländern besonders betroffen ist, direkt oder indirekt verstärkt. Die Grafik aus dem Economist zeigt den dramatischen Trend seit Mitte des Jahre 2008 (Die Arbeitslosenstatistik dürfte noch deutlich schlechter ausfallen als hier auf der Basis offizieller Datenangaben dargestellt).
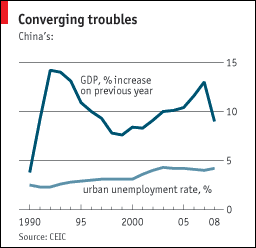
Auslandsinvestitionen bzw. ihr Rückgang sind neben Warenexporten von herausragender Bedeutung für die soziale Stabilität in China, zumindest wenn diese gemäß dem offiziellen Mantra von einem mindestens acht-prozentigen Wachstum abhängt. Während das Exportvolumen seit dem November 2008 einen stetigen Rückgang verzeichnet, verringerten sich die ausländischen Direktinvestitionen im November und Dezember 2008 verglichen mit dem Vorjahr um 36,5% respektive 5,7%. Daher gab sich Wen Jiabao während seiner Europareise, die vor allem der Wiederherstellung des Vertrauens in den chinesischen Wirtschaftsstandort diente, auffallend bescheiden. Er verband seine eindringliche Werbung um neue Investoren mit dem unmissverständlichen Hinweis, dass China sein gewohntes Wachstum nicht wird aufrecht erhalten können. Die ängstliche Stimmung in den höchsten Führungsebenen der kommunistischen Partei ist keineswegs der Auswuchs einer blinden Paranoia, sondern ein untrügliches Anzeichen für die vorrevolutionäre Stimmung, die sich zur Zeit bedingt durch die Wirtschaftskrise von unten nach oben in allen Regionen und Bevölkerungsschichten Chinas ausbreitet. Was den möglichen Kräften des Wandels allerdings bislang fehlt, ist eine schlagkräftige (landesweite) Organisationsstruktur. Die Regierung scheint ihrerseits in Fortsetzung der Reformen des sozialen Sicherungssystems mit weitreichenden Maßnahmen für die Arbeitsuchenden Massen der Wanderarbeiter reagieren zu wollen, um eine soziale Eskalation zu vermeiden. Es bleibt zu hoffen, dass bei allen möglichen und unmöglichen Entwicklungen Ironie eine wichtigere Rolle spielt als Gewalt.
Siehe Aktuelles zum Brand des CCTV-Gebäudes bei
Danwei.

MaxM - 13. Feb, 20:10

